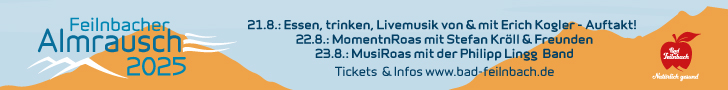Bereits seit dem frühen Mittelalter existiert der Beruf des Fassmachers in Deutschland. Abhängig von Region und Dialekt gibt es die unterschiedlichsten Bezeichnungen dafür. Häufig finden wir diese noch in Straßen- oder Familiennamen wieder, was uns wahrscheinlich auf dem ersten Blick gar nicht so bewusst ist.
Jedoch haben alle unterschiedlichen Namensgebungen etwas gemeinsam – es wird immer ein Gefäß mit regionaler Größe bzw. Maßeinheit beschrieben – von diesem leitet sich dann die Handwerksbezeichnung ab. So kennt man in Preußen und Sachsen die Kufe als Volumenmaß – hiervon leitet sich der Name Küfner ab. Im niederdeutschen ist die Bezeichnung „Böttcher“ bzw. im plattdeutschen der „Böttjer“ zu finden, dieser kommt von dem Gefäß, dem Bottich. Der Schäffler wiederum ist vor allem in Südbayern zu finden. Hergeleitet wird dieser Name von einem „Schaff“ welches oben geöffnet ist.
Trotz modernster Technik hat sich der Herstellungsvorgang in den letzten Jahrhunderten wenig bis gar nicht geändert. Als erstes muss das Holz für die Dauben, das ist die Bezeichnung der hölzernen Wangen, zugeschnitten werden. Wichtig ist dabei, dass das Holz dafür exakt gewinkelt wird und in der Mitte breiter als an den Enden ist – nur mit dieser Form kann man daraus später ein Fass machen. Als nächstes werden die Bretter aufgestellt. Das heißt, die Dauben werden in einen Eisenreifen eingepasst und die oberen Enden gleich ausgerichtet. Die entstandene Form wird dabei Rose genannt.
Dann folgt der wichtigste Schritt des Fassmachens – das biegen der Dauben. Hierfür werden weitere Eisenreifen auf die stehenden Bretter aufgezogen und in der Mitte des Fasses ein Holzfeuer entzündet, welches die Dauben biegsam macht. Wichtig ist dabei, dass die Bretter an der Außenseite laufen nass gemacht werden. Durch die entstandene Biegsamkeit werden die Dauben am anderen Ende mit Hilfe eines Fasszuges zusammengezogen. Danach wird das Fass gedreht und entsprechend bereift und darf erstmal abkühlen. Nach einem Tag Ruhepause kommt das Nachfeuer und Rösten auch Toasten genannt. Beim Nachfeuern werden die inneren Spannungen der Fassdauben minimiert und der Grad der Röstung (leicht/mittel/stark) bestimmt – diese beeinflusst später den Geschmack des gelagerten Gutes. Im vorletzten Schritt werden dann die Fassdeckel und -böden hergestellt und eingesetzt und zu guter Letzt wird das Fass noch gehobelt und geschliffen und das Spundloch gebohrt.
War ein Schäffler in der Vergangenheit nicht aus dem öffentlichen Leben wegzudenken, wurde der Beruf gegen Ende des 19. Jahrhundert von der Industriellenfertigung sehr stark verdrängt. Der Umstieg vor allem auf Kunststoff-, Aluminium- und Edelstahlfässer zwang viele Handwerksbetriebe zum Aufhören – zum Glück nicht alle. Hatten in der schnelllebigen Neuzeit Holzfässer vor allem noch einen nostalgischen Dekorationszweck, gab es immer noch Weinmanufakturen und Brauereien, welche ihr Erzeugnis auch weiter in Holzfässer lagerten, da sich der Geschmack und das Aroma besser entwickelt.
Heute sind deutschlandweit nur noch weniger Küfnereien und Schäfflerbetrieb übriggeblieben. Jedoch steigt mittlerweile die Nachfrage nach Holzfässern wieder, da das Holz dem Inhalt je nach Röstung einen eigenen besonderen Geschmack verleiht. Herzlichen bedanken möchten wir uns bei der Fassbinder Franz Pommer aus der Steiermark, welcher uns die Beschreibung und Bilder zur Verfügung gestellt hat.
Bericht und Bilder: Florian Podhorny, GTEV Immergrün Kolbermoor (Gauverband I)
Die Rose – aufgestellte Dauben Biegen der Dauben
Fass mit Fasszug Rösten oder Toasten des Fasses