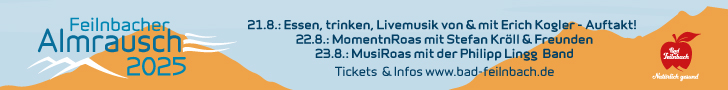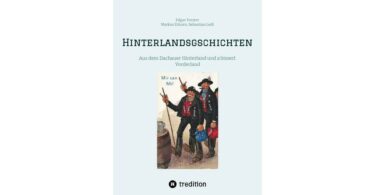Der bayerische Schriftsteller Gerd Holzheimer widmet sich in seinem neuen Buch “Ein stummer Hund will ich nicht sein” (Allitera Verlag) einer herausragenden Persönlichkeit des bayerischen Widerstands, dem katholischen Pfarrer Korbinian Aigner, der im KZ Dachau heimlich Apfelsorten züchtete, darunter den berühmten “Korbiniansapfel”, der heute noch weltweit als Erinnungsbaum an Gedenkstätten und anderen Orten gepflanzt wird – in der Fünfseenregion u.a. in Bernried und jüngst in Fürstenfeldbruck.
Zeitgleich zum Buch startet mit gleichem Titel der Film von Walter Steffen bundesweit in den Kinos. In Bayern stehen zu den Filmvorführungen in zahlreichen Kinos Lesungen mit Gerd Holzheimer auf dem Programm. Wann und wo ist einer Liste im Anhang zu entnehmen. (In Oberbayern u.a. Lesungen in Penzberg, Murnau, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz, Bad Reichhall, . Außerdem stellen wir Ihnen ein Interview mit Gerd Holzheimer und Walter Steffen zur honorarfreien Verwendung zur Verfügung.
Zum Buch: Kann man als Häftling im KZ neue Apfelsorten ziehen?
Ja. Man kann, wenn man Korbinian Aigner (1885–1966) heißt.
Zweitens: Kann man aus Versehen weltberühmt werden?
Ja. Man kann, wenn man Korbinian Aigner heißt. Und Pfarrer war, der sich in einem kleinen Dorf in der Kirche und im Religionsunterricht gegen die Nationalsozialisten gewandt hat, wofür sie ihn erst ins Gefängnis, dann ins Konzentrationslager Dachau gesperrt haben. Weil seine Liebe außer der Gemeinde auch den Obstbäumen gehörte, gelang ihm, was im Grunde gar nicht zu glauben ist: im KZ neue Apfelsorten – »KZ 1«, »KZ 2«, »KZ 3«, »KZ 4« – zu ziehen. Aus vielen Apfelkernen waren rund 120 Sämlinge entstanden, die Aigner, kein kleineres Wunder, von der SS unbemerkt aus dem Lager schmuggeln ließ.
Seit wann und von woher rührt Korbinian Aigners »Liebe zum Apfel«? Und warum wollte er, der als ältestes von elf Kindern das Erbe eines stattlichen Großbauernhofs antreten sollte, Pfarrer werden? Gerd Holzheimer entwickelt in diesem Band ein Gesamtbild der Persönlichkeit Aigners sowie von Widerstand und Überleben in dunkler Zeit.
Zum Autor: Gerd Holzheimer, Dr. phil., geboren 1950, ist Autor und literarischer Landvermesser, Leiter literarischer Exkursionen zwischen Würm, Amazonas, Mandovi-River und Ammer oder Amper. Er wirkte an dem Film »Trüffeljagd im Fünfseenland« mit, verfasste Buch und Drehbuch dafür. Holzheimer ist künstlerischer Leiter der Veranstaltung »Literarischer Herbst« im Landkreis Starnberg und Herausgeber der Zeitschrift »Literatur in Bayern«.
EIN STUMMER HUND WILL ICH NICHT SEIN – Filmvorführungen und Lesungen mit Gerd Holzheimer
Gauting, Breitwand Kino 24. April, 20 Uhr
Tutzing, Kulturkino 25. April, 20 Uhr
Penzberg, KinoP 26. April, 19 Uhr
Landsberg, Olympia Kino 27. April, 11 Uhr
Murnau, Griesbräu-Kino, 28. April, 18.45 Uhr
Garmisch-Partenkirchen, Hochland Kino, 29. April, 20 Uhr
Bad Tölz, Capitol-Kino, 30. April, 20 Uhr
Rottach-Egern, Kino am Tegernsee, 4. Mai, 17 Uhr
Fürstenfeldbruck, Lichtspielhaus, 5. Mai
Trostberg, Stadt-Kino, 6. Mai, 18.30 Uhr
Wolfratshausen, Kino-Center, 7. Mai, 19.30 Uhr
Immenstadt, Unio-Filmtheater, 15. Mai, 19 Uhr
Bad Reichenhall, Park-Kino, 16. Mai, 19.30 Uhr
—————————————————————————————————————————————————————————————
Interview mit Dr. Gerd Holzheimer & Walter Steffen – (17. Dezember 2024)
Maren Martell
Walter, Dein neuer Film „Ein stummer Hund will ich nicht sein!“ folgt dem Schicksal eines sehr außergewöhnlichen Mannes. Worum geht es in diesem Film?
Walter Steffen
In unserem neuen Film geht es um den sogenannten Apfelpfarrer Korbinian Aigner. Er ist auf einem Bauernhof in der Nähe von Freising groß geworden und war von Kindheit an durch die Erziehung seiner Mutter ein großer Fan von Apfelbäumen.
Obwohl er der älteste Sohn auf dem Hof war, wollte er unbedingt Priester werden. Das hat er auch geschafft, aber im Abschlusszeugnis des Priesterseminars haben sie ihm bescheinigt, dass er wohl mehr Pomologe, also Apfelkundler wäre, als Theologe. Er war auch ein sehr politischer Mensch und hat sich dann später gegen die Nazis gewendet. Von der Kanzel aus hat er eine klare Haltung gezeigt.
Deswegen landete er 1941 schließlich im KZ Dachau und hat dort – und das ist für mich das Besondere – zwischen den Baracken, also nach seiner Zwangsarbeit, neue Apfelsorten gezüchtet. Das ist mehr als außergewöhnlich. Es grenzt an ein Wunder, dass ihm das gelungen ist.
Er nannte seine Züchtungen KZ1, KZ2, KZ3 und KZ4. Einer dieser Apfelbäume hat bis heute tatsächlich überlebt und wird als Erinnerungsbaum weltweit gepflanzt. Diese symbolhafte Kraft des Apfelbaums und seine Hinwendung zum Schöpfer, zur Schöpfung, die er damit vollzogen hat, das hat eine große Kraft und Stärke.
Das ist die Hauptgeschichte unseres Films.
Maren Martell
Gerd, wie kam es zu diesem Filmprojekt? Welche Idee steckt dahinter?
Gerd Holzheimer
Also ich bin dem Pfarrer Aigner 1994 zum ersten Mal begegnet in einer Ausstellung in Südtirol, da waren diese Apfelbilder ausgestellt. Ich hatte vorher nie von ihm gehört und habe das gesehen und war völlig geplättet ob diesem Augenblick.
Dort wurde seine Geschichte dargestellt und eben auch die Geschichte erzählt, dass er im KZ Apfelsorten gezüchtet hat. Ich konnte diese Geschichte nicht glauben, weil ich dachte, das gibt es nicht. Jahrzehnte später war ich in ganz anderen Zusammenhängen mit ein paar Leuten in einem VW Bus. Und dort erzählt mir jemand, er war der Ministrant vom Pfarrer Aigner und dass er mit ihm im ehemaligen Konzentrationslager in Dachau war und ihm dort die Stelle gezeigt hat, wo er die Apfelbäume gezüchtet hat.
Danach habe ich dem Walter Steffen, mit dem ich ja schon einiges zusammen gemacht habe, gesagt: „Ich möchte, dass du das machst. Diese Geschichte müssen wir zwei erzählen. Und er hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Zu Recht, weil Geschichten, die im Konzentrationslager spielen, die können einen sehr belasten. Und das war auch so und das ist brutal. Also ich kämpfe heute noch damit.
Walter Steffen
Vor allen Dingen hatte ich meiner Frau bereits vor fünf Jahren versprochen, dass ich keinen solchen Film mehr machen werde, so einen Film den ich dann als Produzent, als Autor, als Regisseur und noch als Verleiher betreuen muss. Das verlangt einem einfach extrem viel Kraft ab, das war mir sehr bewusst.
Es gab also dieses Versprechen an meine Frau, dass ich so etwas nicht mehr anstelle, weil es ja gerade im Dokumentarfilm immer ein relativ hohes finanzielles Risiko bedeutet. Gerade im Alter mit nicht mehr so hohem Einkommen muss man sehr gut überlegen, ob man dieses Risiko noch eingehen möchte. Aber der Gerd hat es immerhin nach zweieinhalb Jahren geschafft, in denen er mir damit immer wieder auf die Füße gestiegen ist, da habe ich dann nachgegeben.
Gerd Holzheimer
Für mich ist es ein unglaubliches Zeichen von Hoffnung, von Überlebenswillen, von so vielem, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Wenn wir da draußen sind in dem Ort Hohenbercha (Aigners ehemalige Kirchengemeinde) da sind tatsächlich noch Bäume aus diesem Ableger von diesem, ich nenne ihn jetzt mal den Urbaum aus dem KZ. Das macht mich so wahnsinnig glücklich. Gerade in dieser Zeit.
Maren Martell
Wer spielt in diesem Film mit? Welche besondere Beziehung haben die Mitwirkenden speziell zu diesem Thema, aber auch zu Korbinian Aigner?
Walter Steffen
Die zentrale Figur des Films ist der Korbinian Aigner selbst, der leider nicht mehr lebt und von dem wir auch keine original Filmaufnahmen haben. Also historisches Material gibt’s da wenig, aber wir haben einen großartigen Schauspieler gefunden, der ihn gespielt hat: Karl Knaup, der ein wirklich großer Glücksfall war. Zum einen kannte ich ihn aus meinen jungen Jahren und es war sehr verblüffend – er sieht heute dem Korbinian Aigner, wie sagt man auf gut bayerisch: runtergerissen ähnlich. Das war wirklich ein großer Glücksfall.
Der nächste Mitwirkende, der eigentlich der Haupt Protagonist des Films ist, der sitzt hier neben mir, der Herr Dr. Gerd Holzhammer. Ich darf ihn Gerd nennen. Er ist Initiator und Co-Autor des Films und er führt die Zuschauer durch den Film. Er ist derjenige, der den Zuschauer bei der Hand nimmt und durch die Geschichte führt.
Also das sind die beiden Hauptfiguren, aber auch Helmut Hörger, von dem der Gerd schon erzählt hat, der ehemalige Ministrant von Korbinian Aigner, der auch ein Glücksfall war. Er ist mit uns noch einmal ins KZ Dachau gegangen und hat uns erzählt, wie es für ihn war, als er als Jugendlicher mit dem Pfarrer Aigner dort hingekommen ist. Und der Pfarrer Aigner hat wirklich nur ihm davon erzählt, was dort passiert ist. Das konnte er uns jetzt als Zeitzeuge weitergeben. Es waren sehr bewegende und berührende Momente.
Ein ganz wichtiger Moment war das Zusammentreffen mit dem Nick Hope, einem inzwischen 100-jährigen Zeitzeugen, der zu gleicher Zeit wie Korbinian Aigner in Dachau war. Er hat zwar nicht im Kräutergarten diese Zwangsarbeit leisten müssen wie Korbinian Aigner, sondern bei BMW in Allach. Er hat uns noch viele persönliche Einblicke ermöglicht in die damalige Zeit. Im Film erzählt er auch eine ganz bewegende, tief bewegende Geschichte von Versöhnung. Durch ihn wird der Film eigentlich zu einem Film über Versöhnung, über das Verzeihen und über die über diese Form menschlichen Größe.
Last but not least ist auch der österreichische Musiker Harri Stojka dabei, ein grandioser Gitarrist, einer der weltweit besten Gitarristen. Sein Großvater Karl Wacker Horvath war zur gleichen Zeit wie der Korbinian Aigner in dem Kräutergarten, wo sie Zwangsarbeit leisten mussten. Bei Harri Stojka merkt man wie die Geschichte nachwirkt – seine Geschichte ist auch die der Sinti und Roma. Fast seine ganze Familie ist im Holocaust umgekommen. Von 200 Menschen haben gerade mal sechs überlebt. Und das erzählt er uns und die Geschichten, die ihm vor allem von seinem Vater erzählt wurden. Und was mich dabei besonders bewegt, ist es zu spüren, wie groß und wie schwer dieses Vermächtnis wiegt. Was diese Menschen, die Nachfahren der Überlebenden auch noch zu tragen haben.
Maren Martell
Gerd, darüber hinaus gab es noch einen ganz ungewöhnlichen Glücksfall, eine ganz ungewöhnliche Begegnung. Es gab noch weitere Mitwirkende in dem Film. Kannst du uns erläutern, welche Begegnung es da gab?
Gerd Holzheimer
Ja, der Film ist ja voller Fügungen. Also wenn ich noch anfügen darf, dass der, was der Walter schon gesagt hat, dass die Besetzung des Pfarrer Aigner als Schauspieler so verblüffend war, dass er aus der Kirche rauskam, also voll aus der Maske quasi und im Talar und der Bürgermeister kommt vorbei und sagt: „Ja, Hochwürden, jetzt haben wir uns aber schon lange nicht mehr gesehen.“ Es gab so unglaublich bewegende Begegnungen, die uns umgeworfen haben, die konnten wir nicht erahnen.
Und in Gauting war es so, dass der stellvertretende Direktor des hiesigen Gymnasiums, Markus Greif, der früher Student von mir war, plötzlich aus dem Nichts auftaucht und sagt, dass er seit vielen Jahren einen Schüleraustausch mit Israel betreut. Es gibt hier einen großen jüdischen Friedhof und das erste Holocaustdenkmal der Republik überhaupt. Und er geht mit den jüdischen Schülern auf den Friedhof und sie entziffern diese hebräischen Inschriften. Das kann ja niemand von uns. Und die deutschen Schüler schreiben mit. Und dann versuchen sie daraus die Geschichten zu rekonstruieren, aus dem Archiv und aus Erzählungen. Da haben wir gesagt: Das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen nicht erinnern, nur noch rückwärts, sondern Erinnerung in die Zukunft. Und wenn das junge Menschen machen, dann ist das der größte Glücksfall überhaupt. Und das wollen wir drin haben.
Maren Martell
Der Arbeitstitel für den Film lautete zunächst „Codename Kräutergarten“. Warum wurde der Titel geändert? Was hat es eigentlich mit dem Kräutergarten auf sich? Der Name klingt ja eigentlich zunächst eher idyllisch.
Walter Steffen
Der „Codename Kräutergarten“ entstand dadurch, dass ich gedacht habe, dass dieses Arbeitskommando, von dem ich schon erzählt habe, das es heute noch in Dachau gibt, wo man noch viel sehen kann, dass das im Film noch mehr im Vordergrund ist.
Es ist auch den meisten Menschen nicht bekannt, dass es dieses Arbeitskommando gab. Es war eine Versuchsanstalt mit einer angegliederten großen Plantage, wo Gewürze und Heilkräuter nach biologisch dynamischen Vorgaben von Rudolf Steiner angebaut wurden. Wie sie es nannten „Zur Gesundung des deutschen Volkskörpers“ aber mit der gleichzeitigen Zielsetzung der Vernichtung durch Arbeit der Häftlinge? Was also der völlige Wahnsinn ist und was uns beide einfach die ganze Zeit beschäftigt hat. Wir dachten, das steht noch mehr im Mittelpunkt, aber während des Machens des Films hat sich dann herausgestellt, dass das Hauptmotiv und der Hauptinhalt des Films diese großartige Figur das Korbinian Aigner ist.
Weil er einfach mutig war, weil er Haltung gezeigt hat und weil er wirklich diesen zutiefst poetischen Akt vollbracht hat, sich der Schöpfung hin zu wenden, gerade in einer Zeit, in der er im absolut tiefsten, mörderischen Abgrund steckte und um sich herum Mord und Totschlag gesehen hat. Da hat er sich dem Leben gewidmet und hat neues Leben so quasi selbst kreiert.
Maren Martell
In dem Film geht es auch sehr ums Verzeihen und Vergebung. Welchen Stellenwert hat dieser Aspekt und was hat dieses Thema eigentlich auch mit Euch oder mit Dir gemacht?
Gerd Holzheimer
Ganz viel. Das hat sich aber erst entwickelt, so wie es der Walter schon gesagt hat. Wir hatten ja erst so ein bisschen den Fokus auf diese Plantage oder den Kräutergarten und dann haben wir immer mehr gemerkt, was noch wichtiger ist.
Das hat uns vor allem dieser Mann gezeigt, der sich Nick Hope nennt. Er hat eigentlich einen ukrainischen Namen, ursprünglich kommt er aus der Ukraine und ist als Zwangsarbeiter verschleppt worden. Er kam nach seiner Befreiung hierher und ist dann, nachdem er nach drei Jahren schwerer Krankheit wieder gesundet war, irgendwann nach Amerika ausgewandert. Und dort hat er sich dann Nick Hope genannt. Das ist ja allein schon so ein großes Symbol.
Und er erzählte uns eine Geschichte, die kann ich kaum wiedergeben, weil sonst fang ich gleich zu Weinen an. Er hat dann seinen SS-Bewacher in Dachau besucht, dann nach dem Krieg, nach der Befreiung, und der hat natürlich wahnsinnig Angst gekriegt, dass der ihn jetzt bei der amerikanischen Besatzungsbehörde dranhängt und er dann eingesperrt wird, weil er ihn gefoltert hat und alles das. Das erzählt Nick Hope in so einer unglaublich anrührenden Geschichte und er sagt: „No, I want to forgive you.“ Und das ist eigentlich einer unserer ganz, ganz großen Sätze und Intentionen. Gerade auch in unserer Gesellschaft, wo wir jetzt gerade anfangen, ja einander eigentlich mal gelinde gesagt, immer weniger zu verstehen. „Hallo, I forgive you!“
Maren Martell
Walter, der Kinostart soll Ende April 2025 sein. Im Mai jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs und damit auch die Befreiung der KZs. Was ist eure Intention?
Walter Steffen
Das ist ein ganz, ganz wichtiges Datum. Die Befreiung des Konzentrationslager Dachau durch die amerikanischen Truppen war eigentlich der Beginn der Befreiung der meisten Konzentrationslager in Deutschland. Dann kam ja auch sehr bald die Kapitulation und die Befreiung von diesem Terrorregime, von diesem mörderischen Regime. Die Intention des Films ist zum einen genau daran zu erinnern, was passiert, wenn wir nicht aufpassen, wem wir unsere Stimme geben, wie das 1933 bzw. 1932 passiert ist. Das ist jetzt ja ziemlich genau 90 Jahre her.
Wir stehen wieder vor Wahlen. Das ist schon ein Aspekt, der für mich sehr wichtig ist, daran zu erinnern und zu hoffen, dass wir nicht den gleichen Blödsinn und den gleichen Unsinn wieder machen. Weil wir können ja sehen, was daraus entsteht. Und das nächste ist dann natürlich auch, die Menschen zu inspirieren durch einen Menschen wie den Korbinian Aigner, der Haltung gezeigt hat, der selbst unter Lebensgefahr und wohl wissend, dass wenn er jetzt in der Schule sagt, was er davon hält, von diesem Attentat auf Hitler und was hätte geschehen können, nicht geschwiegen hat. Dabei wusste er genau, was ihm drohte. Trotzdem hat er es getan. Ich glaube, das ist gerade in heutigen Zeiten wichtig, wo wir oftmals nicht den Mund aufmachen, weil wir schon denken, ja, was sagt denn der andere dazu? Da ist es ganz wichtig, dass wir Haltung zeigen. Es ist wichtig, dass wir mutig sind, es ist ganz wichtig, dass wir auch mutig sind den Menschen gegenüber, die gegen all das sind, für was der Korbinian Aigner stand, nämlich Mitmenschlichkeit, Hinwendung zu Schöpfung, Freiheit, Demokratie, Meinungsfreiheit. Wir müssen uns dafür einsetzen und den Menschen, die das zerstören wollen, denen müssen wir unsere klare Meinung sagen. Das, glaube ich, ist meine persönliche Intention.
Maren Martell
Gerd, wen wollt Ihr mit diesem Film erreichen?
Gerd Holzheimer
Ja, wenn ich jetzt sage „Alle“, ist das vielleicht ein bisschen lapidar, aber das stimmt natürlich. Aber vor allem wollen wir auch junge Menschen erreichen und dass der Film in die Schulen geht. Da hat der Walter ja viel Erfahrung und das funktioniert auch. Oder auch in die Gedenkstätten der Konzentrationslager, der internationalen Holocaust-Gedenkstätten von Israel bis Amerika und sonst wohin.
Das ist natürlich schon unser Anliegen, dass die auch Material haben und sehen: Es gab auch die andere Seite, es gab Menschen, die mutig genug waren, unter Einsatz ihres Lebens Symbole zu setzen für Hoffnung, für Leben. Vor allem für Leben, für Überleben.
Walter Steffen
Zu allererst kommen natürlich die die Kino-Vorstellungen. Da hoffe ich, dass wir so viele Kinos wie möglich gewinnen. Und wir werden den Film dort auch präsentieren. Was mich besonders freut, und was jetzt mein lieber Freund noch nicht gesagt hat ist, dass er gleichzeitig zu dem Film ein Buch schreibt über den Korbinian Aigner. Was ich ganz, ganz großartig finde, weil so ein Film immer relativ beschränkt ist in dem, was er tatsächlich erzählen kann, von so einem großartigen Leben. Das Schöne ist, dass jetzt zusammen mit dem Film das Buch vom Gerd erscheint über diesen Menschen und über diese Zeit und dass dort ganz vieles drinsteht, was der Film eben nicht erzählen kann. Wir planen da auch Lesungen im Kino mit diesem Buch. Ich habe jetzt schon ganz viele Anfragen von Menschen, die gesagt haben, wenn der Film dann bei uns läuft, dann machen wir auch eine Baumpflanzaktion.
Ich habe so das Gefühl, dass sich zusammen mit dem Film zusammen noch ganz viel ergeben wird und dass eben ganz viele neue Bäume gepflanzt werden, die dann diese Idee vom Korbinian weitertragen. Das zeigt sich gerade so an. Obwohl wir noch gar nicht viel unternommen haben, kommen diese Meldung und ich denke, das wird schön.
Maren Martell
Walter, mit deinem Film Endstation Seeshaupt hast du dich ja schon einmal mit dem Thema Holocaust auseinandergesetzt. Was macht das mit dir, wenn man sich gleich zweimal filmerisch mit diesem doch sehr schweren Thema beschäftigt.
Walter Steffen
Also auf jeden Fall macht es mit mir, dass ich mir gerade überlegt: Was schreibe ich jetzt Heiteres oder was möchte ich Heiteres tun, demnächst nach diesem Film?
Wir haben den Film jetzt fast fertig. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun, aber er ist eigentlich fertig und ich spüre so ein Bedürfnis, etwas Heiteres zu tun, was auch damals nach Endstation Seeshaupt so war und was mir damals gar nicht so klar war. Heute weiß ich, was auf mich zukommt. Wir haben uns jetzt fast drei Jahre damit beschäftigt und das wirkt einfach nach. Tatsächlich werde ich die nächsten Jahre nicht mehr in die Gedenkstätte Dachau gehen, in die KZ Gedenkstätte. Jedes Mal, als wir dort gedreht haben, habe ich direkt gespürt, was an diesem Ort war. Das ist einfach eine Energie, die dort wirkt, die die muss man aushalten können. Vor allem, wenn man sich das bewusst macht. Ich bewundere auch alle Menschen, die dort arbeiten. Ja, ich freue mich wirklich darauf, tatsächlich etwas Komödiantisches zu machen oder zu schreiben oder zu filmen,
Maren Martell
Gerd, parallel zum Film wird ja auch dein Buch erscheinen auch zu dem gleichen Thema. Welche Recherchen sind da vorausgegangen?
Gerd Holzheimer
Durch das andere Genre kann man andere Geschichten erzählen. Was im Film nicht möglich ist, kann man im Buch machen und umgekehrt. Darum ist der Film auch nicht der Film zum Buch und das Buch nicht das Buch zum Film.
Es sind zwei ganz eigene Geschichten, natürlich beide mit dem gleichen Thema, nämlich Pfarrer Aigner. Die Recherchen, die ich aber parallel machen konnte, die haben sich zum Teil auch beim Dreh ergeben. Das sind Zeitzeugenerzählungen, das sind Archivbesuche, das sind Quellen literarischer Art, die kann man im Film nicht so unterbringen, aber im Buch schon.
Maren Martell
Für die Rolle des Fahrers Korbinian Aigner wurde der bayerische Charakter-Schauspieler Karl Knaup gewonnen, das ist Dir gelungen. Wie kam es dazu und wieso fiel Deine Wahl gerade auf ihn?
Walter Steffen
Also ich kenne den Karl tatsächlich schon über 50 Jahre, als ich befreundet war mit seinem jüngeren Bruder, dem etwas bekannteren Schauspieler Herbert Knaup. Der Herbert hat immer viel von seinem großen Bruder erzählt, der bereits Schauspieler war. Und dann haben wir uns auch getroffen, in Sonthofen, in der Wohnung bei seinen Eltern, da war der Karl auch immer wieder mal da. Ich weiß noch, dass der Herbert zu ihm aufgeschaut hat, als großem Bruder, der schon ein richtiger Schauspieler war und in Filmen mitgewirkt hat. Ich glaube auch, dass für den Herbert Knaup der große Bruder derjenige war, der ihn dann auch zu diesem Beruf gebracht hat. Ich wollte den Karl schon mal besetzen in einem Spielfilm von mir, da war er auch schon etwas älter.
Zu Beginn dieses Filmprojekts habe ich das Foto vom Korbinian Aigner gesehen und habe mich an den Karl erinnert und hab dann mal nachgeschaut, wie er heute aussieht. Und da dachte ich mir: Potzblitz, die schauen ja wirklich gleich aus! Also so, das ist die Vorgeschichte dazu. Und dann habe ich ihn Karl angerufen, ob er sich noch erinnert. Und er sagte, „Na klar, ich erinnere mich an dich“ und dann sind wir gleich ins Allgäuerische verfallen und haben uns gefreut. Dann habe ich ihm von der Geschichte erzählt und meinte, er würde ihn wohl nicht kennen, den Korbinian Aigner, der hat in Hohenbercha gelebt. Da meinte der Karl; „Was Hohenbercha?! Ich wohne da gleich ums Eck im Nachbardorf.“ Und dann erzählte er mir, dass er heute dort auch immer zum Stammtisch ins Gasthaus Hörger geht, an den gleichen Stammtisch, an dem auch der Pfarrer Aigner saß. Und plötzlich überschnitten sich ganz viele Dinge und es war total klar … also ob er jetzt eine Inkarnation vom Korbinian Aigner ist, das weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall viel dabei. Der Karl ist auch wirklich mit Feuer und Flamme dabei, er fragt immer nach und er hat auch schon Ausschnitte gesehen. Ja, ich glaube, er ist sehr glücklich, dass er diese Person spielen konnte und dass er dadurch so etwas Sinngebendes tun konnte.
Was mir noch wichtig ist zu dem Film, was mir gerade noch einfällt: Ich glaube, wir haben bisher keinen Film gemacht oder nur wenige Filme, wo so viel filmische Formen enthalten sind. Wir erzählen in dem Film unterschiedliche Situationen mit unterschiedlichen Stilmitteln. Zum Beispiel über Animationssequenzen in dem Stil einer Graphic Novel. Also gerade so Sachen, die wir sonst nur schwer zeigen könnten, wie z.B. das Appell-Stehen in KZ. Wie war dieser Terror der SS-Schergen in im Lager? Wie hat der Korbinian Aigner dort seine Bäume gepflanzt? Ich hatte da ein bisschen Bammel davor, dies animationsmäßig zu erzählen, aber inzwischen finde ich das ganz schön und poetisch. Wie sich das alles zusammenfügt mit der Filmmusik und dem Sounddesign, dank der tollen Arbeit von Steffen Mühlstein und dem Frank Cmuchal, unserem Animationsteam. Das umzusetzen ist ihnen wirklich großartig gelungen.
Es gibt dem Film noch eine eigene, junge Note. Ich weiß auch, dass die jungen Menschen das sehr schätzen werden.
Bericht und Bilder: Maren Matell / Allitera-Verlag